Melden Sie sich bei getAbstract an, um die Zusammenfassung zu erhalten.

Melden Sie sich bei getAbstract an, um die Zusammenfassung zu erhalten.
Gotthold Ephraim Lessing
Laokoon
oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie
Reclam, 2012
Was ist drin?
Lessings Laokoon war ein Wendepunkt in der europäischen Kunsttheorie.
Worum es geht
Die Unterschiede zwischen Literatur und bildender Kunst
Lessings Laokoon war ein Eingriff in die kunsttheoretische Debatte seiner Zeit. Ausgehend von der Kritik an J. J. Winckelmanns Schriften zur Kunst des Altertums entwickelte Lessing eine Vorstellung der Möglichkeiten und Wirkungen von Literatur und Malerei, die vom Mainstream abwich. Das Werk markierte einen Wendepunkt in der Ästhetik: Vor Laokoon galt die Malerei als die vornehmere, edlere Kunst, die der Poesie ihre Beurteilungskriterien lieh. Damit räumte Lessing auf. Weil die Poesie von ihren Rezipienten mehr Einbildungskraft fordert, betrachtete Lessing sie als weiter und umfassender als die bildende Kunst. Das unhinterfragte Schönheitsparadigma und der detailverliebte Expertenstreit mit unendlichen Lektürebelegen aus der Antike mögen heutige Leser zwar ziemlich ermüden. Zumindest aus historischer Sicht ist dieser Text aber äußerst interessant, ist er doch ein Meilenstein auf dem Weg zu einer modernen Kunstauffassung.
Take-aways
- Lessings Laokoon ist einer der bedeutendsten Beiträge zum Kunstverständnis der Aufklärung.
- In Auseinandersetzung mit dem „Star“ der Altertumsforschung, J. J. Winckelmann, entwickelte Lessing ein neues Verständnis von Kunst und Literatur und ihrer Wirkung.
- Inhalt: Malerei und Poesie können nicht nach den gleichen Kriterien bewertet werden. Die Poesie ist die weitere, umfassendere Kunst. Sie fordert mehr Einbildungskraft des Rezipienten, weil sie die Schönheit durch bewegte Handlungen zeigt. Die Malerei dagegen stellt die Schönheit durch Anordnung von Körpern im Raum dar.
- Der Titel ist eine Anspielung auf die berühmte antike Skulptur der Laokoon-Gruppe. Sie stellt den Todeskampf des Priesters Laokoon und seiner Söhne dar.
- Obwohl Lessings Text ein Fragment blieb, erlangte er große Bedeutung für die zeitgenössische Kunstdebatte.
- Die seit Jahrhunderten anhaltende Bewunderung der griechischen und römischen Kunst fand hier eine neue Auslegung.
- Mit seinem Fachwissen über antike Kunst und Literatur fand Lessing in Expertenkreisen ein großes Echo, erzeugte aber auch einen Kleinkrieg über Nebensächlichkeiten.
- Lessing brach die Arbeit am Laokoon ab, als er ans Hamburger Nationaltheater berufen wurde.
- In der Kunsttheorie markiert Lessings Text einen wichtigen Schritt weg von der Nachahmungs- und hin zur Wirkungsästhetik.
- Zitat: „Es bleibt dabey: die Zeitfolge ist das Gebiete des Dichters, so wie der Raum das Gebiete des Mahlers.“
Zusammenfassung
Die Griechen und der Schmerz
Griechische Helden werden in der antiken Literatur mit übermenschlichen Fähigkeiten, aber mit menschlichen Gefühlen gezeigt. Sie leiden, sie schreien und weinen bei Verlust und körperlichem Schmerz. Ihr Heldenmut speist sich nicht aus verbissenen Affekten (wie es etwa in nordischen Heldensagen der Fall ist), sondern aus dem Nebeneinander von ungezügeltem Gefühlsleben und unerschrockener Tat. In der darstellenden Kunst der Antike zeigt sich der Gefühlsausbruch jedoch nicht mit gleicher Intensität wie in der Literatur. Woran liegt das?
„Der erste, welcher die Mahlerey und Poesie mit einander verglich, war ein Mann von feinem Gefühle, der von beyden Künsten eine ähnliche Wirkung auf sich verspürte. Beyde, empfand er, stellen uns abwesende Dinge als gegenwärtig, den Schein als Wirklichkeit vor; beyde täuschen, und beyder Täuschung gefällt.“ (S. 7)
Die Begründung für dieses Phänomen, die Johann Joachim Winckelmann in seinem Werk Von der Nachahmung der griechischen Werke in der Mahlerey und Bildhauerkunst liefert, kann nicht stimmen. Winckelmann spricht in Bezug auf das Skulpturenensemble der Laokoon-Gruppe von einer „grossen Seele“, die „weit über die Bildung der schönen Natur“ hinausgehe. Die Gründe für den gedämpften Affekt im Kunstwerk liegen aber nicht, wie Winckelmann behauptet, in der Besinnung auf das Große, Erhabene, Ideale, das die niederen Äußerungen des Menschlichen hinter sich lässt. Wer das annimmt, urteilt vom Standpunkt des modernen Europäers, der die Beherrschung der Affekte positiv beurteilt. Das von der römischen Antike übernommene Heldenbild des Gladiators steht hier Pate für die Beurteilung der dargestellten Helden in antiken griechischen Kunstwerken – und das führt in die Irre.
„Daß die Poesie die weitere Kunst ist, daß ihr Schönheiten zu Gebothe stehen, welche die Mahlerey nicht zu erreichen vermag; daß sie öfters Ursache haben kann, die unmahlerischen Schönheiten den mahlerischen vor zu ziehen: Daran scheinet er gar nicht gedacht zu haben (...)“ (über Joseph Spence, S. 75)
Winckelmann nennt im Vergleich zu dem erhaben leidenden Laokoon in der Skulptur die literarische Schilderung von Vergil ein „schreckliches Geschrey“. Diese implizite Abwertung des Dichters gegenüber dem Bildhauer ist weder gerechtfertigt noch erhellend. Der gedämpfte Affekt der Skulptur entspringt vielmehr zwei Quellen: erstens dem ungeschriebenen Gesetz, der Künstler habe stets das Schöne zu bilden, nicht das Hässliche – und das menschliche Gesicht, vom Schrei entstellt, ist nun mal nicht schön; zweitens dem Umstand, dass die Darstellung des höchsten Leides dem Betrachter keinen gedanklichen Spielraum mehr lässt. Die Geschichte hinter dem Bildnis ließe sich nicht weiterdenken. Angedeutetes Leid erzeugt Mitleid; das höchste Elend – zumal für die Ewigkeit eingefroren – erzeugt dagegen Abscheu.
Henne oder Ei?
Was war zuerst da: die literarische Laokoon-Schilderung in der Aeneis von Vergil oder das berühmte Skulpturenensemble einer dreiköpfigen griechischen Künstlergruppe? Einige Argumente stützen die Vermutung, der Römer Vergil habe die Vorlage für die Bildhauer geliefert. Es ist denkbar, aber nicht belegt, dass es sich bei der Skulptur um eine gedämpfte Version der literarischen Leidensgeschichte mit begründeten inhaltlichen Abweichungen handelt (z. B. steckt Vergils Laokoon im Priestergewand, die Marmorgruppe zeigt den Helden und seine Söhne nackt). Umgekehrt finden sich keine Gründe, aus dem schön leidenden Laokoon in Stein eine wüst schreiende Figur im Text zu machen.
„Bey dem Artisten dünket uns die Ausführung schwerer, als die Erfindung; bey dem Dichter hingegen ist es umgekehrt, und seine Ausführung dünket uns gegen die Erfindung das Leichtere.“ (S. 95)
Die von Kunsttheoretikern wie dem Engländer Joseph Spence vertretene Auffassung, ein Großteil der literarisch beschriebenen Handlungen in der Antike sei auf entsprechende bildliche Vorlagen zurückzuführen, beraubt die Dichtung ihrer Schönheit und degradiert sie zur Kopie. Die Kenntnis der Natur, der behandelten Gegenstände, der Geschichten selbst ist es, die dem antiken Schriftsteller als Basis für seine Textschöpfung dient. Ähnlichkeiten in der Darstellung zwischen Bildnis und Text bei gleichem Gegenstand taugen bestenfalls zur wechselseitigen Erläuterung. Wer den antiken Dichtern generell die Nachschöpfung bereits vorhandener Werke der bildenden Kunst unterstellt, setzt sie herab. Umgekehrt ist die Nachschöpfung der bildenden Kunst auf der Basis literarischer Werke keine simple Kopie. Diese Übersetzung von der einen in die andere Kunst unter Maßgabe der Schönheit ist eine ebenso originale Leistung.
Zwei eigenständige Künste
Der französische Kunsttheoretiker Graf Caylus verlangt von den Künstlern, dass sie sich an Homer, dem „grössten mahlerischen Dichter“, orientieren – und zwar nicht nur inhaltlich an der Handlung, sondern auch formal an der Beschreibung äußerer Merkmale der Figuren. Dieses Abkupfern aber hätte den gleichen entwertenden Effekt auf ein Bildnis, wie umgekehrt die simple äußerliche Beschreibung einer Figur in der Literatur den Beigeschmack der Kopie hat. Vieles, was Homer beschreibt, ist bildlich gar nicht umzusetzen, beispielsweise das unsichtbare Wirken der Götter in der Schlacht. Die Malerei muss also Zeichen finden und die nicht darstellbaren Aspekte einer Szene versinnbildlichen. Dass diese Zeichen nicht unmittelbar vergleichbar sind mit denen im literarischen Text, liegt auf der Hand. Es ist Unsinn, zu erwarten, dass die verbergende Wolke, hinter der ein Gott im Bild für den Menschen unsichtbar wird, auch im Text auftaucht. Die Wolke ist die unvermeidliche Krücke, auf die das Bild sich stützen muss, denn Unsichtbares kann die Malerei nun mal nicht zeigen. Homer vermeidet denn auch die simple Beschreibung äußerlicher Merkmale in seinen Werken fast vollständig, da sie nicht primäre Aufgabe der Poesie ist. Poesie und Malerei folgen zwar beide der Fantasie, aber nach verschiedenen Regeln. Das rechtfertigt ihren Status als jeweils eigenständig wirksame Kunst.
Das Nebeneinander und das Nacheinander
Die Malerei nutzt für ihre Darstellung „natürliche Zeichen“, z. B. die Ähnlichkeit mit einem echten, denkbaren oder vorgestellten Gegenstand. Wie in der Natur sind diese Zeichen Körper im Raum. Die bildende Kunst ist daher nur imstande, Gegenstände abzubilden, die sich nebeneinander im Raum befinden, nicht aber zeitliche Abfolgen. Wo sie dies dennoch versucht, verfehlt sie ihre schöne Wirkung auf den Betrachter und wildert in Jagdgründen, die der Poesie vorbehalten sind.
„Gegenstände, die neben einander oder deren Theile neben einander existieren, heissen Körper. Folglich sind Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften, die eigentlichen Gegenstände der Mahlerey.“ (S. 115)
Da die Poesie eine sprachliche Kunst ist, nutzt sie „willkührliche Zeichen“, die mit der Nachahmung von in der Natur vorgefundenen Objekten nicht unmittelbar zu tun haben. Sie übersetzt die nebeneinander vorgefundenen Naturdinge in ein System aufeinanderfolgender Zeichen. Die Darstellung einer räumlichen Gesamtansicht von Körpern kann die Poesie, wenn sie ihren Namen verdient, nicht leisten. Sie kann nur Handlungen abbilden, die sich nacheinander in der Zeit befinden. Eine simple Beschreibung von Körpern degradiert den poetischen Text zur kunstfreien Rede, denn es fehlt ihr das entscheidende Moment der Täuschung, das darin besteht, dass man als Leser ganz mit den Ideen und Eindrücken beschäftigt ist, die der Dichter erweckt, und dass man dabei das Mittel, das er dazu benutzt, nämlich die Worte, ganz vergisst. Wenn Homer den Schild des Achilles beschreibt, so tut er dies im Rahmen einer Erzählung über dessen Entstehung. Er präsentiert das Objekt nicht als vollendete, sondern als werdende Waffe. Der Dichter beschreibt die Schönheit einer Figur nicht anhand einer Aufzählung von Attributen, sondern er schildert ihre Geschichte oder ihre Wirkung auf Figuren der Handlung und befeuert damit die Vorstellungskraft des Lesers.
In der Poesie ist die Schönheit in Bewegung
Die Schönheit der Helena zeigt Homer uns nicht mit schmückenden Adjektiven, sondern indem er die alten Männer der Stadt Troja bei ihrem Anblick augenblicklich verstehen lässt, warum zwei Völker sich ihretwegen jahrelang im Krieg befinden. Diese Schönheit scheint alles Leid zu rechtfertigen. Wenn wir alte Männer, die wir uns als ehrwürdig und wenig feurig denken, so begeistert geschildert bekommen, dann macht dies einen weitaus stärkeren Eindruck auf uns als eine Auflistung äußerlicher Merkmale der Helena. Wer das geschilderte Gefühl, das der poetische Text anbietet, nachvollziehen kann, der empfindet Schönheit ebenso intensiv wie der Betrachter einer vollkommen gestalteten Skulptur. Wenn Ariost seine wunderschöne Alcina in einer Mischung aus äußeren Attributen und deren Wirkung auf den Betrachter schildert, dann ist es immer die geschilderte Wirkung, die uns bewegt, nicht das kalte Aufzählen von Merkmalen. Es ist die Bewegung, die Handlung, die beschriebene Reaktion, die es der Poesie ermöglicht, Schönheit für den empfindsamen Betrachter fühlbar zu machen. Der Reiz, der hieraus entsteht, ist flüchtig, denn der Text fährt fort. Aber die bewegte Schönheit prägt sich dem Gedächtnis nachhaltiger ein, als die unbewegten Farben und Formen eines Bildnisses es können.
Das Hässliche in der Poesie
Das Gebot aller Kunst ist die Schönheit. Aber bei den großen Dichtern der Antike hat auch die Darstellung des Hässlichen ihren Raum. Und gerade hier finden sich bei Homer Aufzählungen äußerer Attribute, was er bei der Schilderung der Schönheit weitgehend vermeidet. Doch haben diese Aufzählungen einen Sinn: Genau wie eine Merkmalliste die Schönheit kalt und weniger wirksam erscheinen lässt, mindert ein Makelkatalog den Eindruck des Hässlichen. Die Hässlichkeit mit den gleichen Mitteln wie die Schönheit, nämlich durch die Schilderung von Handlungen, nachfühlbar zu machen, hieße den Geschmack des Lesers zu strapazieren. Sie im Rahmen einer Aufzählung darzustellen, mindert ihre Wirkung.
„Gegenstände die auf einander, oder deren Theile auf einander folgen, heissen überhaupt Handlungen. Folglich sind Handlungen der eigentliche Gegenstand der Poesie.“ (S. 115)
Da die Poesie als sprachliche Kunst aufeinanderfolgende Zeichen nutzt, stellt sie die Hässlichkeit immer in einen Kontext. Die Wirkung des Hässlichen ist also nur Teil des Gesamteindrucks. Eine neue Wirkung gewinnt die Hässlichkeit durch weitere Elemente. Hässlichkeit in Verbindung mit einer edlen Seele erregt unsere Hochachtung. Kommen noch körperliche Gebrechen hinzu, die die Entfaltung der Seele hindern, weckt das einen anderen Affekt in uns: das Mitleid. Dagegen gibt Hässlichkeit in Verbindung mit Überheblichkeit die geschilderte Figur der Lächerlichkeit preis. Verursacht die hässliche Figur tragische Momente der Handlung, so wird sie schrecklich.
Ekel und Hässlichkeit in der bildenden Kunst
Die Hässlichkeit der Natur verliert in der Poesie durch die Übersetzung vom Nebeneinander der geschilderten Körper in ein Nacheinander der Erzählung an Stärke. In der bildenden Kunst dagegen funktioniert es nicht, diese Wirkung abzuschwächen. Die räumliche Nachahmung eines räumlichen Objekts in der Natur lässt die Hässlichkeit unübersetzt und daher in voller Stärke bestehen. Die Auffassung der aristotelischen Kunstbetrachtung, dass nämlich die getreue Abbildung widriger Gegenstände durchaus Vergnügen bereiten könne – und zwar durch das Moment der Wissbegierde –, greift bei der Empfindung der Hässlichkeit nicht. Wissbegierde ist ein kurzzeitiges Phänomen. Ist sie gestillt, bleibt der Eindruck des Hässlichen in vollem Umfang bestehen.
„Die Mahlerey kann in ihren coexistirenden Compositionen nur einen einzigen Augenblick der Handlung nutzen, und muß daher den prägnantesten wählen, aus welchem das Vorhergehende und Folgende am begreiflichsten wird.“ (S. 116)
Die Empfindung des sichtbar Hässlichen ist sowohl in der Natur als auch in ihrer bildlichen Nachahmung am ehesten mit der Empfindung des Ekels vergleichbar. Wenn Moses Mendelssohn den Ekel als Empfindung den „dunklen Sinnen“ Geruch, Geschmack und Tastsinn allein zuschreibt, dann greift seine Definition zu kurz. Auch die Betrachtung eines deformierten Gesichts kann Ekel hervorrufen, und zwar sowohl in der Natur als auch im Bild oder in der Skulptur. Die Darstellung des Hässlichen, Ekelhaften weckt im ersten Augenblick zwar die Sensationslust, aber wenn diese verflogen ist, bleiben Ekel und Hässlichkeit auch in ihrer räumlichen Nachgestaltung das, was sie sind: natürliche, unausweichliche, negative Empfindungen. Und diese zu wecken, ist nicht die Aufgabe der Kunst.
Winckelmann und seine Fehler
Nach Erscheinen von Winckelmanns Geschichte der Kunst des Altertums müssen einige Fragen in Bezug auf antike Kunstwerke neu erörtert werden. Die erste interessante Frage ist die nach dem Alter der Laokoon-Gruppe. Winckelmann nimmt an, sie sei in der Blüte der griechischen Bildhauerkunst, zur Zeit Alexanders des Großen, entstanden. Intensive Quellenstudien geben aber vielmehr Grund zu der Annahme, die Plastik sei zur römischen Kaiserzeit, also wesentlich später – und nach Entstehen von Vergils Aeneis – geschaffen worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die bildenden Künstler Vergils Text kannten, bleibt trotz Winckelmanns neuer Untersuchung immer noch größer als die der umgekehrten Entstehungsreihenfolge.
„Es bleibt dabey: die Zeitfolge ist das Gebiete des Dichters, so wie der Raum das Gebiete des Mahlers.“ (S. 130)
Auch in Bezug auf ein weiteres berühmtes Kunstwerk des klassischen Altertums, den Borghesischen Fechter, müssen Winckelmanns Aussagen ergänzt werden: Es gibt Hinweise, dass es sich bei dem Fechter um das Abbild des athenischen Feldherrn und Strategen Chabrias handelt. Dieser Umstand ist Winckelmann ebenso entgangen wie zahlreiche andere Dinge. Dass er sich zu sehr auf ein einzelnes Werk des niederländischen Philologen Franciscus Junius von 1637 verlässt, ohne die Originalquellen zu prüfen, macht viele seiner Behauptungen unbrauchbar.
Zum Text
Aufbau und Stil
Lessings Laokoon umfasst 29 Kapitel. Dabei handelt es sich jedoch nur um den ersten Teil eines geplanten dreibändigen Werks, das Fragment blieb. Das Buch ist ein kunsttheoretischer Essay, der nicht den Anspruch auf die systematische Ordnung eines Lehrbuchs erhebt. Lessing entwickelt seine Ideen aus der Anschauung bzw. aus der Lektüre antiker Kunstwerke und Texte und vergleicht seine Eindrücke mit den Auffassungen, die in den gängigen Lehrwerken vertreten werden. Wo er Widersprüche erkennt, belegt er sie mit Originalzitaten aus antiken Texten. Häufige Fußnoten mit weitläufigen Exkursen sind ein wichtiger Bestandteil des Buchs. Originalzitate in Griechisch, Lateinisch, Französisch und Englisch setzen weitreichende sprachliche Fertigkeiten seiner Leser voraus. Auch die Kenntnis der erwähnten Dichter und der mythologischen Gestalten wird vorausgesetzt. Lessing wendet sich häufig polemisch gegen Autoren, die herkömmliche Vorstellungen der Kunstgeschichte unreflektiert übernehmen. Fehlernachweise werden mit zahlreichen Beispielen aus den Originalquellen erbracht. Oft leitet Lessing seine Schlüsse mit langen logischen Ketten, mit Indizienbeweisen und parallelen Lektüren verschiedener Autoren ab. Ein häufiges Stilmittel ist die rhetorische Frage. Es kommt deutlich zum Ausdruck, dass Lessing seine Streitschrift mit großem Selbstvertrauen verfasste und sich ihrer Bedeutung bewusst war.
Interpretationsansätze
- Im Laokoon liefert Lessing eine der Grundlagen für die werkimmanente Kunstkritik. Nicht die Erschaffung eines Ideals ist Ziel und Bewertungskriterium der Kunst, sondern die neue Schöpfung, in der darstellendes Medium und dargestellter Gegenstand eine Einheit bilden. Ein Bild oder eine Skulptur ist dann gelungen, wenn das Nebeneinander des Gegenstands mit dem Nebeneinander der Darstellung harmonisch korrespondiert. Entsprechendes gilt für die Poesie: Ist das Nacheinander des geschilderten Inhalts harmonisch an das Nacheinander der poetisch-sprachlichen Zeichen gekoppelt, dann ist der poetische Text gelungen.
- Im Laokoon zeigt sich auch ein Wandel von der Ästhetik der Vor- und Darstellung zur Ästhetik der Auffassung. Lessing ist der erste Kunsttheoretiker, der die psychologische Verfassung des Betrachters und Lesers als entscheidenden Teil des Rezeptionsvorgangs einbezieht. Mit dem zentralen Begriff der „Einbildungskraft“ macht er den vernünftigen und sinnlich begabten Konsumenten von Kunst und Literatur zum Qualitätsmaßstab.
- In Lessings Erhöhung der Poesie gegenüber der bildenden Kunst zeigt sich ein Charakterzug der bürgerlichen Aufklärung. Im Schönheitsgebot der Malerei und Bildhauerei fand sich vor allem die herrschende aristokratische Klasse repräsentiert. Die zeitgenössische Interpretation der Laokoon-Gruppe als Darstellung heroisch erduldender, edler Seelen entsprach dem Selbstverständnis des Adels. Haltung und Würde, Anschaulichkeit und Unmittelbarkeit galten als Attribute der Malerei und der Aristokratie. Einbildungskraft, Fantasie, Bewegung und Mitleid, das waren demgegenüber die von Lessing propagierten Attribute der Poesie und des Bürgertums.
- Das Werk hat auch eine gewisse antichristliche Tendenz: Lessings positive Darstellung des griechischen Menschen als natürlich empfindende Figur ist ein Gegenbild zur christlich motivierten Unterdrückung der Leidenschaften.
- Die in ihrer Schärfe vielleicht nicht notwendige Auseinandersetzung mit Winckelmann hatte in erster Linie den Zweck, Aufmerksamkeit zu erregen. Ein lauter Widerspruch gegen den „Star“ der Altertumsforschung musste zwangsläufig für Wirbel sorgen.
Historischer Hintergrund
Streit um das Altertum
Im Jahr 1506 grub ein Weinbauer in Rom die Marmorstatue des Laokoon und seiner beiden Söhne – im Todeskampf verstrickt mit zwei Schlangen – aus der Erde. Dieser Fund befeuerte die ohnehin schon große Begeisterung der gebildeten Welt für das Altertum. Die Renaissance, die Wiedergeburt der Antike, war in vollem Gang. Kunst und Literatur der alten Griechen und Römer wurden zum Maßstab auch aller neuen Künste. Aus der ursprünglich „antiken Mode“ wurde bis zur Romantik Anfang des 19. Jahrhunderts ein zentraler Strang der europäischen Kulturgeschichte.
Die Auseinandersetzung mit der Antike prägte auch die „Querelle des Anciens et des Modernes“, einen Gelehrtenstreit, der vom Frankreich des späten 17. Jahrhunderts ausgehend auch den deutschsprachigen Raum erfasste. Hiesige Hauptvertreter dieses viel beachteten Streites waren der Leipziger „Literaturpapst“ Johann Christoph Gottsched auf der einen und die Schweizer Johann Jacob Breitinger und Johann Jacob Bodmer auf der anderen Seite. Gottsched betonte den auf strenge Regeln gegründeten, von der aufgeklärten Vernunft geleiteten Zugang zur antiken Kunst. Die Nachahmung des Echten, Möglichen und Idealen war nach Gottscheds Auffassung ihr Ziel. Die Schweizer dagegen betonten die freie Schöpferkraft der Fantasie und verteidigten die mittelalterliche, also „neue“ Kunst gegen die antike. Die Schweizer Schule sollte sich durchsetzen – nicht zuletzt durch die Weiterentwicklung einiger ihrer Thesen in Lessings Laokoon.
Entstehung
Breitingers Critische Dichtkunst und Bodmers Critische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie waren wichtige Bezugspunkte für Lessings Arbeit. Darüber hinaus griff er in seinem Laokoon auf verschiedene Strömungen der europäischen Kunstdebatte zurück. Großen Einfluss hatten Jean-Baptiste Dubos’ Kritische Betrachtungen über die Poesie und Malerei und Denis Diderots zeichentheoretische Unterscheidung der poetischen von der unpoetischen Sprache. Ebenfalls von Bedeutung waren englische Sensualisten wie John Locke oder David Hume, die das Moment der sinnlichen Erfahrung bei jeder Wissensaneignung ins Zentrum ihrer Überlegungen stellten. Dreh- und Angelpunkt aber war Johann Joachim Winckelmanns viel beachtetes Werk Von der Nachahmung der griechischen Werke in der Mahlerey und Bildhauerkunst.
Winckelmann prägte die Diskussion um die Laokoon-Gruppe Mitte des 18. Jahrhunderts mit seinem Postulat der „edlen Einfalt“ und „stillen Größe“ der Figuren. Lessing, der vermutlich 1763 in Breslau mit der Arbeit an einer Abhandlung über die Grenzen der Malerei und Poesie begonnen hatte, sah hier den publikumswirksamen Aufhänger für seinen Essay, den er daraufhin überarbeitete. Mitten in die Niederschrift des ersten Teils des Laokoon platzte 1764 Winckelmanns neues Werk Geschichte der Kunst des Altertums. Um seine Konzeption nicht erneut umwerfen zu müssen, behauptete Lessing, er habe dieses zweite Werk des berühmten Archäologen erst gegen Ende seiner Niederschrift zur Kenntnis genommen (was seine Aufzeichnungen widerlegen). Als er 1766 zur Ostermesse in Berlin den ersten Teil des Laokoon veröffentlichte, waren ein zweiter und ein dritter Teil, in denen u. a. auch Musik und Tanz Thema sein sollten, in Arbeit. Wegen Lessings Engagement am Hamburger Nationaltheater und einer Bibliothekarsstelle in Wolfenbüttel blieb der Text jedoch Fragment. Die Notizen zu den Fortsetzungen, die Lessings Bruder 1788 unter der Bezeichnung „Paralipomena“ der zweiten Auflage des Laokoon postum beifügte, geben einen Eindruck vom geplanten Umfang des Werks.
Wirkungsgeschichte
Obwohl Lessings Laokoon fragmentarisch blieb, war die Wirkung der Schrift auf die Zeitgenossen enorm. Die ersten Reaktionen allerdings waren von einer Mischung aus Lob und Unverständnis geprägt. Mit dem Philologen Christian Adolph Klotz entwickelte sich ein rechthaberischer Kleinkrieg um historische Details in Lessings Quellen, der anfangs die Auseinandersetzung mit dem Laokoon bestimmte. Johann Gottfried Herder widersprach Lessing 1769 in seinem Werk Kritische Wälder in vielen Einzelheiten, griff andere, grundlegende Fäden des Essays aber auf und spann sie weiter. Große Wertschätzung erfuhr Laokoon später von Johann Wolfgang von Goethe. Der Dichterfürst brachte es in seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit auf den Punkt, als er dem Laokoon bescheinigte, dass er „uns aus der Region eines kümmerlichen Anschauens in die freien Gefilde des Gedankens hinriss“. In der Kunsttheorie markiert Lessings Text einen wichtigen Schritt weg von der Nachahmungs- und hin zur Wirkungsästhetik. Er ist somit das Bindeglied zwischen einer älteren und einer modernen Kunstauffassung. Von hier aus entwickelten sich die verschiedenen Disziplinen der Ästhetik weiter.
Über den Autor
Gotthold Ephraim Lessing wird am 22. Januar 1729 als Sohn eines Pfarrers im sächsischen Kamenz geboren. Er studiert Theologie, Medizin und Philosophie in Leipzig und Wittenberg. Bereits in seiner Jugend verfasst er Dramen: Sein erstes Stück Der junge Gelehrte wird 1748 uraufgeführt. Von 1748 bis 1755 ist er Mitarbeiter der Berlinischen Privilegierten Zeitung. Er entscheidet sich dafür, freier Schriftsteller zu werden. In Wittenberg beendet Lessing sein Studium mit der Magisterwürde, danach betätigt er sich in Berlin als Theater- und Literaturkritiker. Es entstehen mehrere Dramen, darunter die Lustspiele Der Freigeist und Die Juden (beide 1749) sowie das erste bürgerliche Trauerspiel Miss Sara Sampson (1755). Von 1755 bis 1758 lebt Lessing wieder in Leipzig. Zusammen mit Johann Gottfried Winkler macht er sich zu einer Bildungsreise durch Europa auf, die jedoch bei Beginn des Siebenjährigen Krieges abgebrochen werden muss. 1758 kehrt Lessing nach Berlin zurück und gründet dort 1759 zusammen mit dem Philosophen Moses Mendelssohn und dem Schriftsteller Friedrich Nicolai die Zeitschrift Briefe, die neueste Literatur betreffend. Lessing selbst veröffentlicht darin mehrere Essays, in denen er u. a. den französischen Klassizismus kritisiert und William Shakespeare als Vorbild für deutsche Dramatiker hervorhebt. Von 1760 bis 1765 fungiert er als Sekretär des Generals Tauentzien in Breslau. 1767 erscheint das Erfolgsstück Minna von Barnhelm. Im gleichen Jahr folgt Lessing der Einladung, als Dramaturg am Deutschen Nationaltheater in Hamburg zu arbeiten. Hier verfasst er sein Grundsatzwerk der Dramentheorie, die Hamburgische Dramaturgie. Doch bereits ein Jahr später scheitert das Projekt Nationaltheater. Ab 1770 ist Lessing Bibliothekar der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel. Es erscheinen seine Dramen Emilia Galotti (1772) und Nathan der Weise (1779). 1776 heiratet er Eva König. Ihr gemeinsames Kind wird an Weihnachten 1777 geboren, stirbt aber schon einen Tag später; die Mutter folgt ihm wenige Tage später nach. Am 15. Februar 1781 stirbt Lessing in Braunschweig.
Meine markierten Stellen
Hat Ihnen die Zusammenfassung gefallen?
Buch oder Hörbuch kaufenDiese Zusammenfassung eines Literaturklassikers wurde von getAbstract mit Ihnen geteilt.
Wir finden, bewerten und fassen relevantes Wissen zusammen und helfen Menschen so, beruflich und privat bessere Entscheidungen zu treffen.
Sind Sie bereits Kunde? Melden Sie sich hier an.











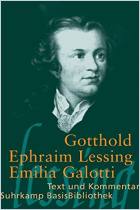





Kommentar abgeben