Join getAbstract to access the summary!

Join getAbstract to access the summary!
Richard Dawkins
Das egoistische Gen
Spektrum, 2007
What's inside?
Dawkins’ revolutionäre These: Wir sind austauschbare Replikationsmaschinen im Dienst unserer Gene.
- Naturwissenschaften
- Moderne
Worum es geht
Sind wir Maschinen unserer Gene?
Gene kennen nur ein Ziel: das Überleben. Um ihre Chancen dafür zu erhöhen, tun sie sich mit anderen Genen zusammen und bauen sich „Überlebensmaschinen“, die gegeneinander antreten oder auch miteinander kooperieren, um ihren Genen auf dem Umweg über die biologische Fortpflanzung bestmögliche Überlebenschancen zu sichern. Das ist im Kern die These von Richard Dawkins. In leicht verständlicher Sprache stellt er die Grundlagen der Evolutionstheorie vor, erklärt, wie die ersten Gene in die Welt gekommen sein könnten, und nimmt den Leser mit auf einen Streifzug durch die moderne Biologie – mit so wenig Fachchinesisch wie nötig, mit eindrucksvollen Beispielen und anschaulichen Metaphern. Dawkins wurde vorgeworfen, er definiere seine Begriffe nicht sauber, seine Sprache sei zu bildhaft und er vereinfache zu sehr, wenn er behauptet, dass es ein Gen für ein bestimmtes Verhalten gebe. Berechtigt oder nicht, das wahre Verdienst des Werkes ist, eine auch für Laien gut nachvollziehbare Darstellung einer radikalen Theorie zu liefern, die auch 40 Jahre nach der Veröffentlichung noch fasziniert.
Take-aways
- Das egoistische Gen ist die berühmteste Schrift des britischen Biologen Richard Dawkins.
- Inhalt: Die Gene sind im Kampf ums Überleben rücksichtslos und egoistisch. Altruismus lassen sie auf biologischer Ebene nur dann zu, wenn es ihrem langfristigen Ziel dient, nämlich ihrer möglichst großen Verbreitung. Dank seines Verstandes kann der Mensch diesen Gesetzen der Evolution etwas entgegensetzen: seine Kulturgüter, die Meme, die selbst dem Evolutionsprozess unterliegen.
- Dawkins ist Vertreter der synthetischen Evolutionstheorie, die die Darwin’sche Evolutionstheorie mit der Mendel’schen Vererbungslehre verbindet.
- Viele Eigenheiten tierischen und menschlichen Verhaltens lassen sich durch die Theorie des egoistischen Gens erklären.
- Der Titel wurde oft missverstanden: Aus dem Gen-Egoismus sollen keine ethischen Schlüsse gezogen werden.
- Noch heute wird die Evolutionstheorie von religiösen Menschen offen angezweifelt.
- Dawkins ist Agnostiker und setzt sich für eine strikte Trennung von Religion und Wissenschaft ein.
- Schon in Das egoistische Gen deutet sich seine ablehnende Haltung gegenüber der Religion an, die er später in weiteren Werken entwickelte.
- Dawkins verzichtet auf Formeln und Fachsprache, er arbeitet mit anschaulichen Beispielen und Metaphern, sodass das Buch auch für Laien verständlich ist.
- Zitat: „Die These dieses Buches ist, dass wir und alle anderen Tiere Maschinen sind, die durch Gene erschaffen wurden.“
Zusammenfassung
Evolution
Charles Darwin hat mit seiner Evolutionstheorie die erste vollständige wissenschaftliche Erklärung für die erstaunliche Tatsache geliefert, dass es Menschen gibt. Das Prinzip der natürlichen Auslese legt nahe, dass es im Verlauf der Evolution um rein egoistische Vorgänge geht. Da ist es umso überraschender, dass es in der menschlichen Gesellschaft, aber auch unter Tieren und sogar Pflanzen, so etwas wie uneigennütziges Verhalten gibt. Altruistisches Verhalten ist aber in Wahrheit immer auf Gen-Egoismus zurückzuführen, beinhaltet also einen Vorteil für solche Gene, die sich sowohl im altruistisch handelnden Individuum als auch, zumindest hypothetisch, in dem Individuum finden, dem die altruistische Handlung zu Gute kommt. Diese Erklärung ist weit aussagekräftiger als die These, dass selbstloses Verhalten dem Erhalt der Art diene. Ebenso wenig lässt sich die Selektion altruistischen Verhaltens damit erklären, dass Gruppen, denen überdurchschnittlich viele altruistisch handelnde Individuen angehören, als Ganzes einen evolutionär signifikanten Überlebensvorteil haben.
Wie alles begann
Das Leben auf unserem Planeten entstand vor unvorstellbar langer Zeit und durch schier unglaubliche Zufälle. Am Anfang stand die Eigenschaft von Atomen, sich zu mehr oder weniger stabilen Gefügen anzuordnen. In unendlichen vielfältigen Kombinationen entstanden aus diesen Formen unter Zugabe von Energie schließlich größere Moleküle. Unter den Abermillionen verschiedener Moleküle war irgendwann auch ein Replikator, ein Molekül, dass zufällig die Fähigkeit besaß, sich selbst zu kopieren. Beim Kopieren kam es immer wieder zu kleinen Abweichungen, von denen einige zu stabileren Molekülen führten als andere. Dank ihrer Langlebigkeit konnten diese stabileren Moleküle mehr Kopien von sich herstellen und so ihre Zahl immer weiter erhöhen. Weitere Gründe für Erfolg und Überleben konnten eine hohe Kopiergeschwindigkeit und eine hohe Kopiergenauigkeit sein: Die natürliche Auslese war geboren. Die Moleküle traten jetzt in Konkurrenz um Ressourcen, sprich um die frei in der Ursuppe flottierenden chemischen Bausteine, aus denen sich weitere Moleküle des jeweiligen Typs zusammensetzen ließen. Besonders erfolgreich waren diejenigen Replikatoren, die sich „Überlebensmaschinen“ bauten, um sich gegen andere Replikatoren durchzusetzen. Die Replikatoren sind nichts anderes als unsere Gene – ihre Überlebensmaschinen sind wir, Menschen, Tiere und Pflanzen.
Wie funktioniert die DNA?
Irgendwann zwischen Ursuppe und heute entstanden aus den ersten Replikatoren lange Nukleotidketten, die wir als DNA kennen und die aus den immer gleichen, aber stets neu kombinierten Bausteinen, abgekürzt mit den Buchstaben A, T, C und G, bestehen. Die menschliche DNA ist in jeder der Milliarden Zellen in unserem Körper enthalten. Sie kopiert sich selbst und koordiniert den Bau von Proteinen. Mit „Gen“ bezeichnet man den Teil der Gesamt-DNA, der für ein bestimmtes Merkmal verantwortlich ist und der per geschlechtlicher Fortpflanzung über einen längeren Zeitraum vollständig weitergegen wird. Gene sind fadenförmig angeordnet und bilden so die sogenannten Chromosomen. Jeder Mensch hat 46 Chromosomen – 23 von seiner Mutter und 23 von seinem Vater. Auf den Chromosomen liegen sich Gene, die sich auf dasselbe Merkmal beziehen, paarweise gegenüber; diese Gene werden Allele genannt. Beide Gene eines Paars können identisch sein oder verschieden – im zweiten Fall ist eines dominant und kommt bei der Konstruktion des Körpers zum Zug, oder es ist rezessiv und bleibt wirkungslos. Die Herstellung der Geschlechtszellen (Samen- und Eizellen), die immer nur 23 Chromosomen beinhalten, geschieht durch Meiose. Dabei werden zufällig 23 Chromosomen aus den 46 des Erzeugers zusammengestellt und in die Geschlechtszelle gegeben. Jede Geschlechtszelle ist genetisch einzigartig und kann aus völlig neuen Chromosomen bestehen, die durch das Crossing-over von Fragmenten entstanden sind.
Erfolgreiche Gene
Baut sich ein Gen eine Überlebensmaschine, die aufgrund bestimmter Eigenschaften besonders überlebenstüchtig ist, steigt die Chance, dass es weitergebeben wird. Um durch natürliche Auslese nicht aussortiert zu werden, muss das Gen egoistisch sein. Es muss sich gegen seine Allele zur Wehr setzen können. Wie erfolgreich ein Gen ist, hängt jedoch auch davon ab, wie gut es mit anderen Genen zusammenarbeiten kann. Ein Chromosom kann man sich als Rudermannschaft vorstellen: Selbst gute Gene können einer schlechten Mannschaft, die nicht gut harmoniert, nicht zum Sieg verhelfen. Die natürliche Selektion mischt einfach so lange alle verfügbaren Ruderer durcheinander, bis diejenigen zusammenfinden, die einander besonders gut ergänzen. Die Siegermannschaft erhält den Preis, dass sie sich besonders schnell vermehrt. Die Gene steuern ihre Überlebensmaschinen, wie Programmierer Computer steuern – indem sie Programme für das Verhalten entwickeln. Sie setzen auf bestimmte Eigenschaften, die sie ihren Überlebensmaschinen mitgeben; diese werden sich dann im Kampf ums Überleben als nützlich erweisen oder auch nicht. Die programmierten Strategien müssen dabei möglichst allgemein und anpassungsfähig sein, um auch unter veränderten Bedingungen erfolgreich zu sein. Dabei haben sich die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen, und die Fähigkeit zur Simulation von Wirklichkeit im Bewusstsein zwecks Zukunftsprognose als besonders hilfreich erwiesen. Das menschliche Bewusstsein ist der Höhepunkt dieser Entwicklung. Es verleiht uns sogar die Macht, uns gegen die Gene aufzulehnen.
Aggression und Verwandtschaftsaltruismus
Überlebensmaschinen stehen immer in Beziehung zu anderen Überlebensmaschinen. Man könnte nun meinen, dass es für das Fortkommen der Gene das Beste sei, alle Konkurrenten auszuschalten, doch dafür findet sich in der Natur kein Nachweis. Tatsächlich bekämpfen sich Artgenossen nur selten auf Leben oder Tod, sondern messen lediglich ihre Kräfte. Für einen solchen dosierten Umgang mit Aggression sprechen verschiedene Gründe. Ein Kampf kostet unter anderem Kraft und Zeit, die vielleicht sinnvoller in andere Tätigkeiten gesteckt werden könnten. Erklären lassen sich diese Vorgänge im Rahmen der Spieltheorie: Für das Verhalten in bestimmten Situationen entwickeln sich evolutionär stabile Strategien, sprich solche, die von keiner anderen Strategie überboten werden können. Dass es in vielen Fällen von Vorteil sein kann, Kämpfen aus dem Weg zu gehen, lässt sich mithilfe der Spieltheorie berechnen und erklären.
„Die These dieses Buches ist, dass wir und alle anderen Tiere Maschinen sind, die durch Gene geschaffen wurden.“ (S. 37)
Ein Gen hat Kopien seiner selbst überall auf der Welt, am wahrscheinlichsten aber in der Verwandtschaft seiner eigenen Überlebensmaschine. Uneigennütziges Verhalten gegenüber den nächsten Verwandten, vor allem den eigenen Kindern, kann darum als Spielart des Gen-Egoismus verstanden werden: Unter Umständen ist die Aufopferung für einen Verwandten so nützlich für die Weitergabe der Gene, dass sie aus gen-egoistischen Gründen in Kauf genommen wird. Der Verwandtschaftsgrad bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Gen mit einem anderen Individuum teilt. Zwischen Geschwistern sowie zwischen Eltern und Kindern beträgt der Verwandtschaftsgrad 1/2. Kosten und Nutzen altruistischen Verhaltens lassen sich berechnen: Es ist von Vorteil, das eigene Leben für beispielsweise mehr als zwei Geschwister oder mehr als vier Onkel aufs Spiel zu setzen. Würde ein Gen dagegen dafür sorgen, dass man sein Leben für weniger riskiert, würde dieses Gen unweigerlich nach einer bestimmten Zeit aussterben. Am Ende der Rechnung steht der Nettovorteil für die Gene, und die Verhaltensweise mit dem höchsten Nettovorteil wird realisiert.
Fortpflanzung und Partnerschaft
Bei Vögeln wurden im Lauf der Zeit nicht diejenigen von der natürlichen Auslese begünstigt, die die größten Gelege hatten, sondern die Tiere mit der jeweils optimalen Gelegegröße – also mit derjenigen Menge Nachkommen, die mit der verfügbaren Zeit und Nahrungsmenge zu möglichst fortpflanzungsfähigen Individuen aufgezogen werden können. Eltern investieren nach diesem Kalkül in ihren Nachwuchs – es muss ihnen daran gelegen sein, für ihre Kosten den Nutzen für ihre Gene zu optimieren. So lassen sich Phänomene wie die Menopause, die Bevorzugung jüngerer Kinder und die Vernachlässigung von Kümmerlingen erklären. Kinder stehen in Konkurrenz zu ihren Geschwistern um die Ressourcen Nahrung und Aufmerksamkeit – bis zu dem Punkt, an dem der Nachteil für die Geschwister größer wird als der eigene Vorteil. Zwischen Eltern, die ihre Ressourcen im Idealfall gleich auf ihre Kinder verteilen, und Kindern, die immer gern ein bisschen mehr als ihre Geschwister hätten, besteht also ein dauerhafter Konflikt, der durch Kompromisse gelöst werden muss.
„Ich trete nicht für eine Ethik auf der Grundlage der Evolution ein.“ (S. 37)
Väter und Mütter haben ein grundsätzliches Interesse an der Fortpflanzung, weil sie ihre Gene weitergeben wollen – aber auch ein Interesse daran, ihre Kosten dafür so gering wie möglich zu halten. Ideal wäre es für das Individuum, Kinder zu zeugen, für die der Partner dann allein sorgt. Männliche Geschlechtszellen sind immer zahlreicher und kleiner als weibliche – es muss also von Anfang an weniger Energie in ihre Produktion gesteckt werden und sie sind immer verfügbar. An diesem Punkt beginnt die Ausbeutung des weiblichen Geschlechts, das wegen der größeren Geschlechtszellen schon bei der Befruchtung höhere Investitionskosten hat und nur begrenzt neue Eizellen produzieren kann. Daher ist es in den meisten Fällen eher der Vater, der ein Kind verlässt, als die Mutter. Die Weibchen können auf diese Situation reagieren, indem sie Wert auf eine lange „Verlobungszeit“ legen, während der sie prüfen, wie treu und fürsorglich der potenzielle Vater ihrer Kinder ist – davon haben übrigens auch die Männchen Vorteile, denn sie können sichergehen, dass das Weibchen nicht bereits Nachwuchs von einem anderen erwartet. Die vier Strategien „leichtfertig“ bzw. „spröde“ (weiblich) sowie „treu“ bzw. „flatterhaft“ (männlich) lassen sich mithilfe der Spieltheorie untersuchen. Im Ergebnis zeigt sich, dass Weibchen vorrangig spröde und Männchen vorrangig treu sein sollten, um die Weitergabe ihrer Gene zu gewährleisten.
Eine neue Evolution
Der Mensch ist in der einzigartigen Lage, sich durch seinen Verstand gegen die natürliche Evolution aufzulehnen – etwa indem er beschließt, keine Kinder zu bekommen. Die kulturelle Vererbung verläuft viel schneller als die natürliche und hat in kürzester Zeit Verblüffendes geschaffen. Diesen Verlauf kann man analog zur natürlichen Auslese betrachten – die kleinste Einheit eines weitergegebenen Kulturguts ist hier das Mem, das sich durch Nachahmung vermehrt. Ein Beispiel für ein äußert erfolgreiches Mem ist die Idee von Gott. Die genselektierte Evolution hat also einen zweiten Replikator, das Mem, hervorgebracht und damit eine neue, rasant verlaufende Evolution gestartet. Auch Meme mutieren, werden selektiert und stehen in Konkurrenz zueinander. Nur besonders überzeugende Meme überleben diesen Kampf ums Dasein und treten mitunter auch in Konkurrenz mit den Zielen der Gene – wie zum Beispiel das Zölibat.
Das Gefangenendilemma
Eines der größten Rätsel der Verhaltensforschung ist, dass es unter Bedingungen der Informationsknappheit prinzipiell vorteilhafter ist, ein Gegenüber auszunutzen, als mit ihm zu kooperieren, und dass es dennoch so oft zur Zusammenarbeit kommt. Dieses Problem wird in der Spieltheorie unter dem Schlagwort „Gefangenendilemma“ untersucht. Es lässt sich mittels Computersimulationen nachbilden und auf die Evolution von Verhaltensweisen übertragen. Zwei Teilnehmer erhalten jeweils zwei Karten: „Zusammenarbeiten“ und „Zusammenarbeit verweigern“. Je nachdem, welche Karte die Teilnehmer ausspielen, erhalten sie eine Strafe oder eine Belohnung. Dabei zeigt sich: Bei nur einer Spielrunde ist es immer die beste Strategie, die Zusammenarbeit zu verweigern. Anders sieht es bei Wiederholungen aus. Hier hat sich die Strategie „Wie du mir, so ich dir“, als eine der erfolgreichsten erwiesen: In der ersten Runde spielt man „Zusammenarbeiten“, danach immer die Karte, die der andere in der vorigen Runde gespielt hat. Diese Strategie ist „nett“, weil sie einen Vertrauensvorschuss bietet, und „verzeihend“, weil sie die Verweigerung der Zusammenarbeit nur eine Spielrunde lang nachträgt. Die Strategie führt zu einem Nichtnullsummenspiel: Keiner verliert, keiner gewinnt, beide Partner sind zufrieden.
Die Wirkung der Gene auf die Welt
Zum Zweck der Anschaulichkeit wird oft davon gesprochen, dass Individuen alles tun, um ihre Gene weiterzugeben. Grundsätzlich nutzen jedoch die Gene die Individuen, um sich zu vermehren – wobei dies natürlich nicht bewusst geschieht, sondern einfach dadurch, dass nur erfolgreiche Gene weiterexistieren. Gene unterscheiden sich stofflich oft nur minimal – die wichtigen Unterschiede zeigen sich in ihren Auswirkungen. Diese können oft sehr indirekt sein. So ist zum Beispiel das Verhalten der Köcherfliege, sich aus Steinchen köcherförmige Behausungen baut, genetischen Ursprungs. Diese Auswirkungen nennt man den Phänotyp eines Gens – dazu zählt zum Beispiel der Einfluss des Gens auf das Aussehen aber auch spezielles Gebaren wie das Bauen von Dämmen im Fall von Bibern oder von Köchern im Fall von Köcherfliegen.
Zum Text
Aufbau und Stil
In Das egoistische Gen nimmt sich Richard Dawkins Großes vor: Er will eine auch für Laien verständliche Antwort auf die Frage liefern, wie Egoismus und Altruismus in der Natur zu verstehen und zu erklären sind. Dazu erläutert er die Grundlagen der Evolutionstheorie, verknüpft sie mit Erkenntnissen der Spieltheorie und verpackt sie in 13 in sich stimmige Kapitel, die einen Überblick über einige der spannendsten Fragen der Biologie liefern. Dawkins verzichtet vollständig auf mathematische oder chemische Formeln; er arbeitet, wo immer möglich, mit anschaulichen Beispielen und metaphorischen Bildern wie zum Beispiel dem der Rudermannschaft. Ein wichtiges rhetorisches Mittel ist auch die Personifizierung seiner Hauptakteure, der Gene: Dawkins erklärt die Vorgänge, als ob die Gene bewusst bestimmte Entscheidungen zugunsten ihrer eigenen Verbreitung treffen würden, macht im Nachsatz aber immer auch deutlich, dass dies metaphorisches Sprechen ist und dass es lediglich so wirkt, als ob die Gene absichtsvoll handeln würden. Sein Stil ist locker und flüssig, sodass das gut 500 Seiten starke Werk auch für Leser mit geringen Vorkenntnissen geeignet ist. Wie Dawkins selbst schreibt: „Mein Ausgangspunkt war, dass der Laie zwar keine Spezialkenntnisse besitzt, aber auch nicht dumm ist.“
Interpretationsansätze
- Im Zentrum von Das egoistische Gen steht die These, dass die natürliche Auslese nicht auf der Ebene von Art oder Individuum, sondern auf der Ebene der Gene wirkt. Um zu überleben, müssen sich Gene gegen ihre jeweiligen Allele durchsetzen, sie sind also grundlegend egoistisch.
- Daraus zieht Dawkins jedoch keine ethischen Schlüsse: Uneigennütziges Handeln ist möglich und sogar wünschenswert, sagt er, allerdings muss man die Menschen dazu erziehen, denn als Überlebensmaschinen ihrer egoistischen Gene tendieren sie ihrerseits zum Egoismus.
- Auch folgt aus den gewonnenen Erkenntnissen kein Determinismus: Gene steuern unser Verhalten nicht zwingend und vollständig, sondern erhöhen lediglich die statistische Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Verhalten.
- Dawkins legt großen Wert auf Interdisziplinarität: Seine Theorie vom egoistischen Gen lebt von der Verknüpfung der Evolutionstheorie mit der Spieltheorie. Außerdem streift das Werk Fragen der Anthropologie, der Erkenntnistheorie, der Ethik genauso wie der Soziologie und der Ökonomie.
- Dawkins’ eigenes Fachgebiet ist jedoch die Ethologie, sprich Verhaltensforschung. Alle Ausführungen zur Genetik und Spieltheorie usw. dienen letztlich dazu, die erstaunliche Vielfalt menschlichen und tierischen Verhaltens wissenschaftlich zu erklären.
- Dawkins’ Theorie der kulturellen Evolution, die auf der Einführung eines kulturellen Replikators, des Mems, beruht, wird in Das egoistische Gen nur angerissen. Dawkins führte sie aber in späteren Werken weiter aus. Außerdem nahmen mehrere andere Autoren diese Idee auf. Die entsprechende Theorie wird als Memetik bezeichnet.
- Im Buch deutet sich Dawkins’ ablehnende Haltung gegenüber der Religion an, die er später in mehreren Werken entwickelte, vor allem in Der Gotteswahn und Die Schöpfungslüge.
Historischer Hintergrund
Von Darwin bis Dawkins
Ausgehend von den Erkenntnissen von Jean-Baptiste Lamarck zum Artenwandel entwickelte Charles Darwin um 1838 seine Evolutionstheorie. Er veröffentlichte seine Erkenntnisse jedoch zunächst nicht – sein Hauptwerk Die Entstehung der Arten erschien erst 1859. Unabhängig von Darwin kam Alfred Russel Wallace um 1858 zu ähnlichen Ergebnissen.
Grundthese beider Denker war, dass sich Lebewesen nach und nach immer besser an ihre Umwelt anpassen und dabei immer komplexere Strukturen bilden. Die (irrtümliche) Schlussfolgerung, dass der Mensch von Affen abstammt und die Schöpfungsgeschichte falsch sein muss, provozierte allgemeine Entrüstung, doch die Wissenschaft war begeistert: Die Evolutionstheorie lieferte das grundlegende Prinzip der Biologie, das bald in den verschiedensten Teildisziplinen bestätigt und erweitert wurde. Wie genau die durch natürliche Auslese bevorzugten Eigenschaften vererbt werden, konnte Gregor Mendel mit seiner 1865 erstmals veröffentlichten Vererbungstheorie erklären, die aber erst 1900 von der Forschung wiederentdeckt wurde.
Der scheinbare Widerspruch zwischen der von Darwin postulierten Wandelbarkeit der Arten und der durch die Mendel’sche Theorie belegten Konstanz wurde erst in den 1930er-Jahren aufgelöst. Ronald Fisher und andere vereinten beide theoretischen Konstrukte in der synthetischen Evolutionstheorie. Die Forschung wurde durch die Entdeckung der DNA in den 40er- und 50er-Jahren beflügelt. Die Erkenntnis, dass die Einheit, um die es bei der natürlichen Auslese geht, nicht die Art oder das Individuum, sondern das Gen ist, setzte sich in zwei Wellen durch: In den 50er- und 60er-Jahren verschoben George C. Williams und andere das Augenmerk von der Art zum Individuum, in den 70ern vor allem Richard Dawkins vom Individuum zum Gen.
Während die Wissenschaft die Evolutionstheorie längst als gegeben hinnimmt, wird die Auseinandersetzung in manchen Ländern auf gesellschaftlicher Ebene weitergeführt: In den USA wird an vielen Schulen die kreationistische Lehre (Schöpfung der Welt durch einen Gott) unterrichtet. Mehr als 40 Prozent der US-Amerikaner glauben, dass Gott den Menschen vor 10 000 Jahren erschaffen hat.
Entstehung
Ein Auslöser für Das egoistische Gen war die Uneinigkeit unter Evolutionstheoretikern darüber, welche Einheit in der natürlichen Auslese selektiert wird: Individuum, Art oder Gen? Für Richard Dawkins war bald klar: Es musste das Gen sein, auch wenn es in kleinen Zeitabschnitten betrachtet so wirken muss, als ob die natürliche Selektion vor allem auf der Ebene des Individuums ausgetragen wird.
Als Dawkins Das egoistische Gen schrieb, war die Biologie in Aufbrauchstimmung: Nicht nur aus der Molekularbiologie, sondern auch aus der Verhaltensforschung kamen neue Impulse. „Heute sehe ich, dass dies eine jener geheimnisvollen Zeiten war, in denen neue Ideen in der Luft liegen. Ich schrieb Das egoistische Gen in einem Zustand, der fieberhafter Erregung ähnelte“, so Dawkins in seinem Vorwort zur zweiten Auflage. Dawkins begann bereits 1972 mit der Arbeit an dem Buch, legte das Werk dann beiseite und setzte sich erst 1975 wieder daran. Ein Jahr später wurde das Buch publiziert. Die zweite Auflage von 1989 wurde um zwei Kapitel ergänzt und nahm die Erkenntnisse aus Robert Axelrods spieltheoretischer Abhandlung Die Evolution der Kooperation auf.
Wirkungsgeschichte
Das egoistische Gen wurde von einer breiten Leserschaft und vielen Kritikern begeistert aufgenommen. Obwohl er viele weitere Bücher schrieb, blieb Das egoistische Gen Dawkins’ bekanntestes und einflussreichstes Werk. Viele Details seiner Theorie wurden in unterschiedlichen Disziplinen weitergedacht, wie etwa die Idee der überschüssigen oder egoistischen DNA in der Biologie oder der Vergleich zwischen dem Bewusstsein und einer Computersimulation in der Philosophie. Die Theorie des Mems wurde vor allem von Geisteswissenschaftlern aufgenommen und weiterentwickelt, unter anderem von Susan Blackmore in ihrer Schrift Die Macht der Meme.
Doch es gab und gibt auch kritische Stimmen: Kritiker, die in Dawkins’ Erkenntnissen fälschlicherweise moralische Implikationen sahen, warfen ihm vor, der sozialen Kälte und der fremdenfeindlichen Stimmung im England der 70er- und 80er-Jahre Vorschub geleistet zu haben. Dawkins selbst fragte sich später, ob der Titel seines berühmtesten Werkes gut gewählt war. Vielleicht, so meinte er, wäre „Das unsterbliche Gen“ oder vielleicht sogar „Das kooperative Gen“ passender gewesen; jedenfalls musste er den Titel über viele Jahre rechtfertigen. Manche Leser warfen Dawkins vor, mit seinem Werk der Welt den Zauber genommen und sie in eine tiefe Depression gestürzt zu haben, weil er für so viele Rätsel eine einfache wissenschaftliche Erklärung fand.
Über den Autor
Richard Dawkins wird am 26. März 1941 in Nairobi geboren, wo sein Vater als Soldat stationiert ist. 1949 zieht die Familie zurück nach England. Dawkins studiert in Oxford Biologie und promoviert 1966 in Zoologie. Im Jahr darauf heiratet er und erhält eine Assistenzprofessur in Berkeley. 1970 kehrt er zurück nach Oxford, wo er bis 1995 als Dozent für Zoologie tätig ist. 1976 veröffentlicht er sein einflussreichstes Werk Das egoistische Gen (The Selfish Gene). Nach der Scheidung von seiner ersten Frau heiratet er 1984 erneut und wird Vater einer Tochter. Nach abermaliger Scheidung heiratet er 1992 zum dritten Mal. 1997 wird er Mitglied der Royal Society. 1995 wird an der Oxford University auf Bestreben von Charles Simony ein Lehrstuhl für „The Public Understanding of Science“ eingerichtet, den Dawkins bis 2008 innehat. Bis heute setzt sich Dawkins für eine stärkere Säkularisierung des britischen Staats und gegen kreationistische Umtriebe ein. Aufgrund seiner offensiv atheistischen Haltung ist Dawkins immer wieder Mittelpunkt erregter öffentlicher Debatten über ethische Themen. Er hält die Existenz Gottes zwar nicht für ausgeschlossen, aber für äußerst unwahrscheinlich. Dieses Thema behandelt er in Werken wie Der blinde Uhrmacher (The Blind Watchmaker, 1986) und Der Gotteswahn (The God Delusion, 2006). Er gründet im Jahr 2006 die Richard Dawkins Foundation for Reason and Science, um die humanistische Forschung zu unterstützen. Dawkins ist Träger zahlreicher Ehrendoktorwürden, Literatur- und Wissenschaftspreise. Dem Time Magazine zufolge zählt er zu den 100 weltweit einflussreichsten Menschen.
Meine markierten Stellen
Hat Ihnen die Zusammenfassung gefallen?
Buch oder Hörbuch kaufenDiese Zusammenfassung eines Literaturklassikers wurde von getAbstract mit Ihnen geteilt.
Wir finden, bewerten und fassen relevantes Wissen zusammen und helfen Menschen so, beruflich und privat bessere Entscheidungen zu treffen.
Sind Sie bereits Kunde? Melden Sie sich hier an.









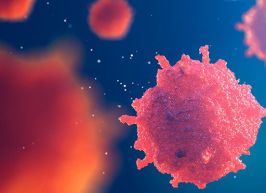



Kommentar abgeben