
Thérèse Raquin
- Roman
- Naturalismus
Worum es geht
Was in uns mordet und die Ehe bricht
Ein fescher Lebemann und eine frustrierte Ehefrau beginnen eine Affäre. Er begehrt ihr Geld, sie seinen Körper und ein aufregendes Leben. Was den beiden im Weg steht, ist nur der naive Gatte der Dame. Also ertränken sie ihn. Doch der Mord fördert ihr wahres Problem zutage: Sie sind Marionetten ihrer unkontrollierbaren Gefühle. In heftigen Angstzuständen und Nervenkrisen erstickt ihre Liebe so schnell, wie sie aufgeflammt ist. Émile Zola war nicht der Erste, der einen Mord aus Leidenschaft schilderte, aber keiner vor ihm ging so radikal vor wie er. Er spricht seinen Antihelden jene Eigenschaft ab, die gemeinhin für die menschlichste gehalten wird: den freien Willen. Die Figuren können nicht anders, es ist die tierische, ja bestialische Natur, die in ihnen handelt. Thérèse Raquin war Zolas erster naturalistischer Roman. Um ihn zu schreiben, studierte er die Naturwissenschaften seiner Zeit, schwor aller Romantik ab und zeichnete ein neues, soziobiologisches Menschenbild. Heute steht Thérèse Raquin im Schatten des großen Romanzyklus Die Rougon-Macquart. Dabei hat schon dieser frühe Roman alles, was den späteren Zola auszeichnet: Spannung, Detailgenauigkeit und einen schonungslosen Blick auf die Welt.
Zusammenfassung
Über den Autor
Émile Zola wird am 2. April 1840 in Paris geboren, verbringt seine Kindheit aber in Aix-en-Provence. Dort gehört der spätere Maler Paul Cézanne zu seinen Freunden. Zolas Vater, ein italienisch-österreichischer Ingenieur, stirbt 1847. Die Mutter zieht daraufhin wieder nach Paris, wo sie sich als Putzfrau und Schneiderin durchschlägt. Zola fällt in Paris gleich zweimal durchs Abitur, er arbeitet bei der Zollbehörde als Schreiber, später im Verlag Hachette als Lagerist, dann als Werbeleiter. 1867 gelingt ihm mit seinem Roman Thérèse Raquin der Durchbruch. Im Rahmen des Romanzyklus Les Rougon-Macquart (Die Rougon-Macquart) schreibt er binnen 24 Jahren 20 Romane. Seine größten Erfolge erzielt er mit L’Assommoir (Der Totschläger, 1877) und La débâcle (Der Zusammenbruch, 1892). Nach Germinal (1885) erscheint 1886 L’Œuvre (Das Werk), nach dessen Lektüre Cézanne empört die Freundschaft abbricht, da er sich in dem Text auf unvorteilhafte Weise porträtiert sieht. Zola mischt sich auch ins politische Zeitgeschehen ein. Berühmt wird er 1898 für seinen offenen Brief an den Staatspräsidenten Félix Faure mit dem Titel J’accuse („Ich klage an“). Darin bezieht er kritisch Stellung zur Affäre um den jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus, der aufgrund gefälschter Beweise als Hochverräter verurteilt wurde. Der Brief beschert Zola eine einjährige Gefängnisstrafe, der er sich jedoch durch die Flucht nach England entzieht, wo er eine deprimierende Exilzeit verlebt. Am 29. September 1902 stirbt Zola in seiner Pariser Wohnung. Als Todesursache gilt eine Rauchvergiftung. Ob es ein Mord oder ein Unfall gewesen ist, bleibt ungeklärt. 1908 werden Zolas sterbliche Überreste ins Pariser Pantheon überführt.








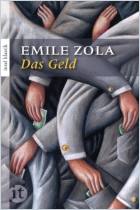
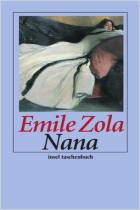

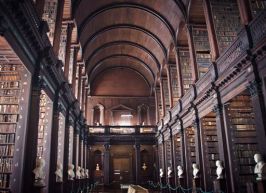
Kommentar abgeben oder Start Discussion